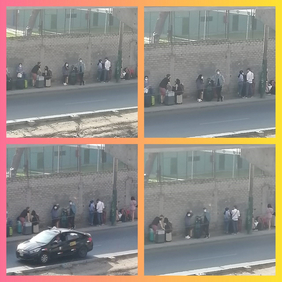Peru wurde meiner Ansicht nach härter durch Corona getroffen, als Deutschland: Die meisten Arbeiten dort verlangen es, dass man physisch anwesend ist und nur die Allerwenigsten haben jetzt das Privileg, aus dem Home Office weiterarbeiten zu können. Viel mehr Menschen gehen einer oder mehreren informellen Arbeiten nach, sodass sie jetzt weder auf Lohnfortzahlung noch Arbeitslosengeld hoffen können. Unter den am meisten Betroffenen im Land sind auch viele Venezolaner, die vorher ihr täglich Brot durch den Verkauf in öffentlichen Räumen verdient haben. Ihnen wurde durch den Lockdown die Lebensgrundlage weggenommen: Nach Verhängung der Ausgangsbeschränkungen sah ich viele Straßenverkäufer auf dem Weg zum Markt. Dort haben sie in der Zwischenzeit Plastikmasken verkauft. Sie wurden von den Polizisten augenscheinlich zwar geduldet, lebten jedoch mit der Ungewissheit, ob sie morgen auch noch verkaufen dürfen würden.
Zu Beginn der Ausgangsbeschränkung war das Schlange stehen für Lebensmittel ein prägendes Erlebnis für mich. In Deutschland sozialisiert ruft das Ausharren für Lebensmittel eher Bilder aus der Vergangenheit hervor – welche die junge Generation nur aus Geschichtsbüchern kennt. Etwa der Situation in Kriegszeiten, oder der Nachkriegszeit. Auf dem Markt und in den nahegelegenen Geschäften drängten sich die Menschen für Reis und Hülsenfrüchte und viele Produkte waren tatsächlich schon vormittags ausverkauft, nachdem der Präsident am Vorabend, Sonntag, dem 15. März verkündigte, dass nur noch tagsüber und nur noch für das Nötigste das Haus verlassen werden dürfe. Es herrschte eine unangenehme Angespanntheit und Nervosität unter den Menschen – die Unsicherheit, wie es wohl weitergehen sollte, lag sehr spürbar in der Luft.
Die Angst vor dem Virus war in Lima stets merklich, denn auf den Straßen patrouillierte neben der üblichen Stadtsicherheit vermehrt die Polizei und auch die Armee, mit einigen Straßenkontrollen. Es wurde zum Beispiel kontrolliert, ob die Maske ordnungsgemäß getragen wurde. Es kam auch vor, dass man nach dem Grund seines Ausgangs gefragt wurde. Lima ist in Peru mit fast einem Drittel der Bevölkerung das absolute Bevölkerungszentrum und dementsprechend sind die strengen Maßnahmen und Kontrollen auch nachvollziehbar. Gleichwohl wurden die Freiheiten stark eingeschränkt, da selbst das Spazieren in benachbarten Parks verboten wurde.
In Lima wohnten wir mit den zwei Brüdern meiner Frau in einer Wohngemeinschaft. Auch unsere Familie war stark von der Pandemie betroffen, denn da die Brüder meiner Frau als Taxifahrer arbeiten, war ihnen ihre Existenzgrundlage entzogen. Seit dem ersten Tag der bis heute geltenden Ausgangsbeschränkung können sie nicht ihrer Arbeit nachgehen (nur die registrierten Taxifahrer mit entsprechenden Autos haben die Erlaubnis, zu zirkulieren). Ohne die Unterstützung ihrer Mutter, die seit Jahrzehnten für ihre Kinder in Italien arbeitet, wäre die Familie tatsächlich in eine sehr schwierige Situation geraten. Über unsere Schwägerin erfuhren wir von zwei Todesfällen durch Corona. Ihr Cousin, gerade einmal 18 Jahre alt, verstarb ebenso wie ein Arbeitskollege ihres Bruders. der für den Milch-Großkonzern Gloria arbeitete. Der Bruder berichtet, dass die Arbeiter dort zurzeit gezwungen werden, weiterzuarbeiten, dass sogar mit Kündigungen gedroht wurde, um Druck auszuüben.
Abschied in Peru – gemischte Gefühle
Inmitten dieser Situation erfuhr ich von den Rückkehrflügen der deutschen Botschaft. Nachdem meine Frau Ende Februar erfolgreich den A1-Kurs bestanden hatte, warteten wir auf die Genehmigung ihres Visums. Ihr Pass lag bei der Botschaft zur Bearbeitung. Nachdem es hieß, dass nur noch zwei Flüge aus Peru rausgingen, trug ich uns in die Passagierliste ein und konnte tatsächlich erreichen, dass ihr Visum aufgrund der besonderen Situation schneller genehmigt werden konnte, der Pass wurde uns beim Sammelpunkt von einem Botschaftsmitarbeiter übergeben. Erst am Vortag des Fluges bekamen wir die finale Bestätigung, wodurch alles schnell gehen musste und wir packten nur das Notwendigste zusammen.
Ohne dass unsere Koffer durchsucht oder gewogen wurden, reisten wir also mit der Spezialmaschine der Lufthansa nach Deutschland. Ich fühlte mich aufgrund des deutschen Passes ein weiteres Mal sehr privilegiert und auch meine Frau fühlte sich durch das schnelle Aushändigen ihres Visums als Individuum wahrgenommen und war beeindruckt, dass alles mit der Übergabe ihres Passes perfekt funktionierte. Sie war überrascht über die leichte Ausreise und dass uns die Flugkosten vorgestreckt wurden erschien ihr ungewöhnlich. Wir beide empfanden für diese Bemühungen auch viel Dankbarkeit. Der Botschafter selbst zeigte durch seine Präsenz am Militärflughafen Empathie mit den Reisenden. Er informierte uns über den weiteren Ablauf und meiner Frau erschien er gerade in so einer angespannten Situation sehr menschlich. Somit war die Ausreise für uns einerseits aufregend, andererseits wären wir gerne unter anderen Umständen nach Deutschland gereist, denn es fühlte sich für uns an, als würden wir unsere peruanische Familie dort zurücklassen. Meiner Frau wurde nicht die Möglichkeit gegeben, sich vor ihrem Umzug in ein anderes Land von Verwandten und Freunden persönlich zu verabschieden, da Besuche zu dem Zeitpunkt strengstens untersagt waren.
Ankunft in Deutschland – völlig anderes Gefühl
Als wir nach Deutschland reisten, waren wir besorgt aufgrund der hohen Zahl an Infizierten in Bayern. Wir rechneten gewissermaßen mit strengen Maßnahmen, da sich ja in Bayern mehr Infizierte als in ganz Peru befanden. Jedoch gab es weder eine bewaffnete Armee auf den Straßen, noch trug jemand eine Maske. Hier wurde uns also nicht das Gefühl gegeben, dass wir uns in jedem Moment anstecken könnten, denn plötzlich interessierte es niemanden, ob der 1,50-Abstand eingehalten wurde (das ging bei der Gepäckabholung los).
Für meine Frau war es deutlich sichtbar, wie unterschiedlich der Umgang mit dem Virus hierzulande ist. Ich erwähnte bereits die allgegenwärtige Präsenz des Virus in den Straßen Limas. Hier hingegen scheint es, dass jeder Einzelne einen gewissen Spielraum hat, wie er mit der Situation umgeht.
Wir bekamen im Flieger noch ein Schreiben ausgehändigt, uns direkt in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne zu begeben. Ich fragte mich, wie denn vorgesehen war, dass wir uns Lebensmittel beschaffen sollten? Zum Glück wohnten wir mit meinen Eltern zusammen, sodass dies kein Problem darstellte. Wir fühlen uns hier mit der Möglichkeit in die Natur zu gehen sehr frei. Es herrschte keine Stimmung der Angst, etwas falsch zu machen, so wie wir das in Lima erlebten. In Peru war die Pandemie im Fernsehen und im öffentlichen Leben stets auf intensive Art und Weise präsent, das erschien uns hier in Deutschland deutlich gemäßigter.
Uns beide verbindet eine große Dankbarkeit hier zu sein, denn durch die Situation in Peru und die Tatsache, dass ich länger als erwartet auf meine Arbeitserlaubnis warten musste, konnte ich dort bis zuletzt nicht arbeiten. Aufgrund der Situation muss meine Frau viel Geduld aufbringen, denn die ihr zustehenden Integrationskurse finden momentan nicht statt und auch ihr Aufenthaltstitel lässt auf sich warten. Doch wenn wir unsere Situation hier in Deutschland mit der vergleichen, die unsere peruanische Familie und die Mehrheit der Personen allgemein in Peru durchmachen müssen, relativieren sich unsere Schwierigkeiten hier sehr. Statt einem Gefühl der Ungewissheit über die Zukunft mit massiver Einschränkung der Freiheiten stellen wir fest, dass wir hier in Deutschland viel mehr die Zeit genießen können, um uns neu zu orientieren und das Leben achtsamer zu erleben.
Kevin Brown
BtE Referent - Er arbeitet hauptsächlich folgenden Themen: Globale Ernährung, Verantwortungsvoller und fairer Konsum, (Post)kolonialismus und sogenannte Entwicklungszusammenarbeit, Alltag in Peru und Religionen.